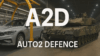„A2D“ – Ist „Auto2 Defence“ tatsächlich ein Impuls für Ingenieur-Arbeitsmarkt
Görlitz – traditionsreicher Waggonbau-Standort seit 175 Jahren, zuletzt für den Weltkonzern Alstom, zukünftig Produktionsstätte des Rüstungsunternehmen KNDS. KNDS plant, in Görlitz verschiedene Baugruppen für den Kampfpanzer LEOPARD 2 und das Schützenpanzerfahrzeug PUMA sowie Module für mehrere Varianten des Radpanzers BOXER zu fertigen.
Wolfsburg – traditionsreicher Automobilbau-Standort … so recht mag sich das Äquivalent kaum vorstellen.
Doch tatsächlich wird angesichts der aktuellen weltpolitischen Situation und der Aufweichung der Verschuldungsobergrenze für Rüstungsausgaben durch die neue Bundesregierung (sieh hierzu auch unseren Beitrag „500 Milliarden Euro Sondervermögen – klingt nach Aufschwung, oder?“) in Kombination mit den Veränderungen in der Automobilindustrie über ähnliche Szenarien unter dem Schlagwort „Auto2Defence“ – ob einem dies nun gefallen mag oder nicht – zumindest nachgedacht …
Der Begriff „Auto2Defence“ wurde vom Bundesverband der Deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie (BDSV): Es geht darum, gezielt Arbeitskräfte und damit deren Kompetenten und Spezialwissen aus der Auto- in die Rüstungsindustrie zu übertragen.
„Zunächst einmal ist das aus Managementperspektive gar nicht abwegig, lässt man wirtschaftsethische Aspekte – über die man durchaus diskutieren kann – außen vor“, kommentiert Prof. Dr. Michael Knörzer vom APRIORI HR:LAB die Grundidee: „Beide Branchen verbinden Dinge wie Antriebs- und Sicherheitstechnologien in der Entwicklung und im Endprodukt, aber auch Herstellungsprozesse am Schnittpunkt von Automatisierung, Robotik und menschlicher Arbeitskraft unter Verarbeitung von vielfältigen Teilen und Komponenten aus der Zulieferindustrie. Da gibt es deutliche Schnittmengen“.
Die Diskussion darüber, ob der Panzer künftig vom (ehemaligen) Autobauer oder Automobilzulieferer kommt, hat gerade erst begonnen – und dürfte noch für reichlich Zündstoff sorgen. Doch wie realistisch ist dieser Umbau tatsächlich?
„Das geht natürlich nicht ohne Anpassung der Produktionsproesse und Technologien. Aber historische Vorbilder – teils auch sehr unrühmliche – dafür gibt es durchaus“, gibt Prof. Knörzer zu bedenken: „Die Umstellung der Automobilindustrie auf militärische Produktion hätte jedenfalls einige – wenn auch teils eher unrühmliche- historische Vorbilder, vor allem in Kriegs- und Krisenzeiten. In der aktuellen Debatte um „Auto2Defence“ gibt es insofern durchaus Parallelen zu vergangenen Industriekonversionen“.
Bekanntestes Beispiel ist der Zweite Weltkrieg. So förderten die USA im Zuge ihrer „Arsenal of Democary“-Ansatzes zur Unterstützung ihrer Allierten den Einsatz ziviler Produktionskapazitäten, Ford, General Motors und Chrysler bauten Panzer (z. B. den M4 Sherman), Lastwagen, Flugzeuge und Munition. In Deutschland produzierten Daimler-Benz, BMW und Opel produzierten militärische Fahrzeuge wie den Kübelwagen, Panzer oder Flugzeugmotoren. In der Sowjetunion stelltenFabriken, die vorher Traktoren oder LKWs bauten, auf die Produktion von Kampfpanzern wie den T-34 um. Aber auch zur Zeit dese sogenannten Kalten Krieges gibt es bekannte Beispiele: In den USA bauten Unternehmen wie Boeing oder Lockheed Martin sowohl Verkehrs- als auch Militärflugzeuge, in Deutschland liefen in den Werften von Blohm+Voss sowohl zivile Handelsschiffe, aber auch Kriegsschiffe und U-Boote vom Stapel, in der Sowjetunion waren Hersteller von Traktoren und Baumaschinen (z. B. Kirov-Werk) oft gleichzeitig auch Produzenten von Panzern und Artillerie.
Neben der technischen Machbarkeit stellen sich auch ethische und gesellschaftliche Fragen. Und betriebswirtschaftlich?
„Zunächst einmal sprechen wie hier von Industrien mit sehr unterschiedlichen Beschäftigtenzahlen. Je nachdem, wie man zählt, ist die Automobilindustrie in Deutschland mindestens fünfmal so groß wie die Rüstungsindustrie. Dennoch zeigt beispielsweise das Interesse von Rheinmetall am VW-Standort Osnabrück oder die Kooperationsabsichten von Continental und Rheinmetall, dass solche strategischen Erwägungen durchaus konkret werden können“, gibt Prof. Knörzer einige Beispiel und skizziert die Arbeitsmarktperspektiven, die sich daruas ergeben: Die Politik muss – wenn sie es mit ihren Verteidigungsanstrengungen ernst meint – eine hohe Lieferfähigkeit an Rüstungsprodukten sicherstellen. Mit Geld allein ist es dabei nicht getan. Beispielsweise braucht es eine europäische Standardisierung von Normen und Teilen von Militärgütern und eine länderübergreifende Nachfragebündelung. Das wird in der EU auch unter dem Begriff „Defence Omnibus“-Regelung vorangetrieben. Dadurch ergeben sich im Idealfall für Rüstungsunternehmen – anders als in der aktuell sehr unsicheren Automobilindustrie – vergleichsweise stabile langfristige Auftragslagen. Wer da als Ingenieur keine ethischen Probleme mit dem Endprodukt hat, findet vielleicht in der Rüstungsindustrie die künftig stabilieren Beschäftigungs- und Aufsteigsperspektiven“.